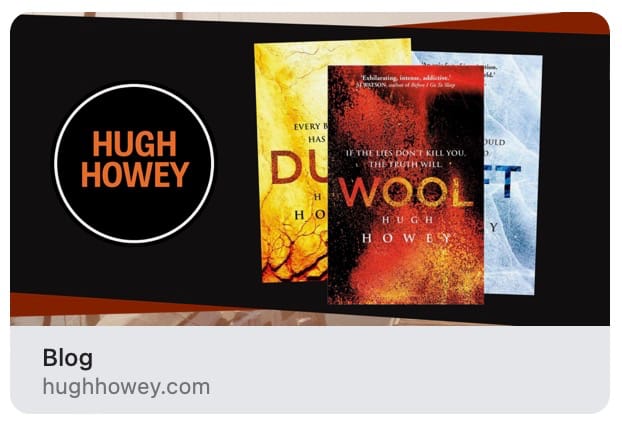Schreibratgeber: Hugh Howey’s Writing Insights
Hugh Howey’s Writing Insights lernte ich kennen, als ich vor ein paar Jahren auf unergründlichen Pfaden unterwegs war, um von erfahrenen Autoren gute Ratschläge für das Schreiben von Geschichten zu finden. Das Wort ‚Roman‘ nahm ich damals noch nicht in den Mund. Ich stieß auf den Blog von Hugh Howey. Howey kannte ich, weil ich Bücher von ihm gelesen hatte. Sein zentrales Werk, um es mal so zu nennen, war und ist „Wool“ (deutsche Ausgabe: „Silo“), das sich nachfolgend mit einem Prequel („Level“) und einem Sequel („Exit“) zu einer Trilogie entwickelte. Das Wort „Wool“ hat im übrigen nichts mit Strickwolle oder Wollpullovern zu tun, sondern ist der Begriff für die Lappen, mit denen diejenigen, die das Silo verlassen wollten oder mussten, die Scheiben von Außen reinigen sollten.
Obwohl „Wool“ unglaublich erfolgreich war und noch ist, hat es hat zehn Jahre gebraucht, bis sich jemand für eine adäquate Verfilmung bereit fand. Mittlerweile ist es ein Glücksfall für die Leser von „Wool“ und die Streaming-Abonnenten von Apple TV+, dass die Geschichte von Juliette, Sheriff Becker und all den anderen in einer ersten Staffel auf den Bildschirm kam. Meine Meinung tendiert dahin, die Bücher vorzuziehen, weil sie erzählerisch deutlich mehr auf den Punkt kommen. Dafür hat die Serie den Vorteil, visuell wirklich gelungen umgesetzt zu sein, auch wenn sich die Story irgendwann zieht wie ein mundwarmes Kaugummi.
Die Erstausgaben von „Wool“ hat Hugh Howey als Selfpublisher veröffentlicht. Aus den Erfahrungen, die sich vom Schreiben des ersten Satzes bis zur Veröffentlichung angesammelt haben, hat er innerhalb seines Blogs eine eigene vierteilige Serie gemacht mit dem Titel „Writing Insights“. Die erschien 2017 und ist erfreulicherweise auch heute noch dort zu finden. Die Texte sind logischerweise auf Englisch, können aber, da frei zugänglich, problemlos per copy & paste in ein Übersetzungsprogramm geladen und anschließend auf Deutsch gelesen werden.
Die vier Teile von Hugh Howey’s Writing Insights sind überschrieben mit:
- Ein Schriftsteller werden (Becoming a Writer)
- Der grobe Entwurf (The Rough Draft)
- Der Überarbeitungsprozess (The Revision Process)
- Dein Buch veröffentlichen (Publishing Your Book)
Der erste Teil hat einen ausgeprägt motivierenden Charakter und versucht, ein paar Wegweiser zu setzen, wie sich ein Schreib-Novize in der manchmal etwas seltsam anmutenden Welt von Literatur und Verlagen zurechtfindet. In Teil 4 bricht Howey die Lanze für das Selfpublishing. Das ist interessant zu lesen, aber nicht der Weisheit letzter Schluss, zumal sich der deutschsprachige Markt vom englischsprachigen bzw. amerikanischen erheblich unterscheidet.
Für angehende Schriftsteller am interessantesten sind eindeutig die Teile 2 und 3, wo es um die Praxis geht. Schon die Unterteilung in zwei eigene Blogbeiträge unterstreicht, welche Bedeutung Howey der Überarbeitung zumisst. Die ist für ihn fast wichtiger als die Rohfassung des Manuskripts. Das erinnert an den Rat Jessica Brodys Save the Cat! – Writes a Novel, erst mal einen Haufen Mist zu schreiben, weil Mist Dünger für Besseres sei und damit eine gute Grundlage für anschließende Überarbeitungen und Korrekturen. Aber vielleicht hat die es ja auch bei Hugh Howey gelesen.
Eine Einschränkung ist insofern zu machen, als sich in Howeys Einteilung ein großer Teil des Schreibprozesses in die Überarbeitung verlagert wird. Das beginnt mit der Ansage „Der Rohentwurf muss nicht gut sein“ und setzt sich fort mit der Feststellung, dass der größte Teil des Schreibens abseits der Tastatur stattfindet und es völlig okay ist, ganze Szenen und Kapitel auszulassen. Das führt konsequent dazu, dass der von ihm beschriebene grobe Entwurf fast auf eine Skizze oder Outline reduziert wird, die sich erst in der Überarbeitung mit Sätzen und Leben füllt. Das ist ein interessanter Gedanke insofern, als damit vermieden wird, sich beim Schreiben in Verästelungen und Geschichten zu verlieren, die die Linie der Geschichte aus den Augen verlieren. Zudem wird die ewige Diskussion um Plotten und Pantsen nahezu überflüssig, weil sich das Pantsen auf Strukturebene dem Plotten stark annähert.
Unabhängig, ob im Rahmen eines Entwurfs oder bei der Überarbeitung, hat das Schreiben abseits der Tastatur unbedingt etwas für sich. Nach meiner Erfahrung kommen, so weit die Idee einer Szene schon steht, die besten Ideen hinsichtlich Ausstattung und Dialogen tatsächlich in denen Momenten, wo die Gedanken frei schweifen können: in der Sauna, öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Wandern oder Schwimmen. Jede Minute ohne äußere Einflüsse kann nutzen, um sich sich den Fortgang der eigenen Geschichte vorzustellen. Die einzigen Orte, wo es entschuldbar ist, keinen Stift und Papier dabei zu haben, sind die Sauna und das Schwimmbecken. Spätestens im Bademantel muss beides verfügbar sein.
Weil der Überarbeitung nicht nur viel Raum gegeben, sondern auch Verantwortung aufgebürdet wird, empfiehlt Howey ein Dutzend oder mehr Durchgänge. Damit ist klar, wann und wo bei ihm das Buch mit Sätzen gefüllt wird. Zitat: „Jeder Durchgang glättet nach und nach raue Stellen und Fehler. Es ist, als ob du ein grob behauenes Stück Holz in ein poliertes Möbelstück verwandelst. Du fängst mit grobem Schleifpapier an und arbeitest dich bis zum Nassschleifen eines Tippfehlers hier oder da vor.“
Howey geht sogar so weit, die Entscheidung über Erzählperspektive und -zeit in die Überarbeitung zu verlagern. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das sinnvoll ist, weil das nicht nur eine technische Frage ist, sondern die grundlegende Perspektive eines Romans betrifft.
Hugh Howey’s Writing Insights sind weniger Schreibratgeber als Erkenntnisse und Einsichten aus seiner eigenen langjährigen Entwicklung als Romanautor. Es ist weniger ein „Soll“, als ein „Ich hab alles mögliche ausprobiert, und das war das Beste“. Und er redet weniger über das Schreiben als über Strukturen, mit denen der Schreibprozess optimiert werden kann.
Nicht zuletzt ist Howey ein großer Motivator. Viele Reflexionen aus seinem eigenen Autorenleben zeigen anschaulich, dass es vor allem auf das Durchhalten ankommt, dadurch aber auch jedes Manuskript ein bisschen besser wird. Dazu gehört, die Erfahrungen aus dem Vorherigen zu beherzigen. So gesehen sind Hugh Howey’s Writing Insights total aus der Praxis und in einem persönlichen Stil geschrieben, der seine Einsichten überzeugend transportiert.
Writing Insights; von Hugh Howey; auf seinem eigenen Blog: hughhowey.com/blog/
Photo by PAN XIAOZHEN on Unsplash
Die meisten Autoren längerer Geschichten haben wahrscheinlich diverse Schreibratgeber im Regal stehen. Warum auch nicht? Es ist deutlich effizienter, sich spezielle Kenntnisse von professionellen Autoren anzueignen, als entsprechende Erfahrungen selbst machen zu müssen. Wie alles sind aber auch Schreibratgeber unterschiedlicher Qualität und sie beleuchten verschiedene Aspekte des selben Themas. In dieser Reihe möchte ich ein paar Worte über die Schreibliteratur verlieren, die ich gelesen habe und die möglicherweise auch für andere interessant sein könnte. Die Zielgruppen dieser Ratgeber unterscheiden sich teilweise aber erheblich.