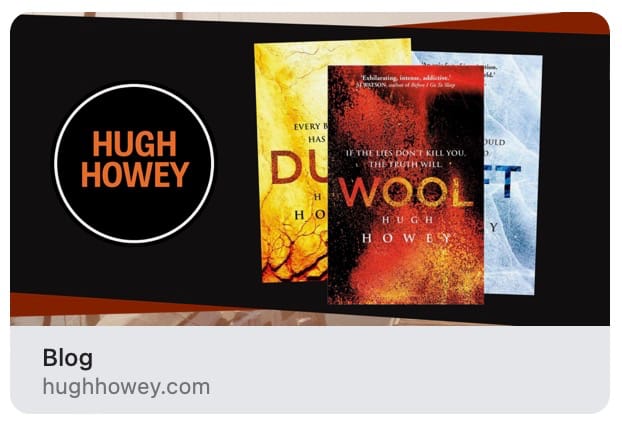Die Entscheidung – Love Between the Pages (Schreibwettbewerb)
In wenigen Tagen, am 20. März 2024, erscheint eine Anthologie von 18 Romancegeschichten mit dem Titel »Love Between the Pages«.
Der Hintergrund dazu ist folgender: Im Juli 2023 lud BoD (Books on Demand) zur Teilnahme an einem Schreibwettbewerb mit dem Titel »Love Between the Pages« ein. Gefragt waren Kurzgeschichten, die (Zitat):
das Thema Buch beinhalten und im Gerne Romance oder Romantasy geschrieben sind. Das heißt, dass dein*e Protagonist*in zum Beispiel in einer Buchhandlung oder Bibliothek arbeitet, Leser*in oder Autor*in ist oder das Thema Buch eine zentrale Rolle spielt.
Bis zum Teilnahmeschluss am 15. September waren über 500 Einsendungen zusammengekommen, aus denen 15 ausgewählt wurden, um im Umfeld von drei »erfolgreichen Autorinnen« in dieser Textsammlung veröffentlicht zu werden. Unter diesen 500+ Autoren (und Autor*innen) war auch ich und habe – wie zu erwarten – keinen Stich gemacht.
Nun ist eine Chance von 3% nicht wirklich überzeugend, zum anderen muss sich die Jury verständlicherweise auch die Frage stellen, in wie weit die Texte zu den vorab feststehenden Geschichten der drei »erfolgreichen Autorinnen« passen. Und ich fürchte, spätestens da sind meine Erfolgsaussichten entgültig auf Null gefallen.
Zugegeben: Als jemand, dem Recherche nicht fremd ist, hätte ich mir mal zumindest die als erste genannte „erfolgreiche Autorin“ D.C. ODESZA genauer anschauen sollen. Auf Amazon steht (Zitat):
Der Name ist das Pseudonym einer jungen, deutschen SPIEGEL- und BILD-Bestseller-Autorin. Ihre Geschichten zeichnen sich durch tiefe Gefühle, sinnliche Momente, tiefbewegenden Handlungen und einem Hauch Spannung und Dunkelheit aus.
Die „Sinnlichen Momente“ wurden in Besprechungen früherer Bücher dieser Autorin in noch ganz andere Regionen geschoben, wo die Sternchen nicht nur zum Gendern benutzt werden. Hmm, wenn ich das gewusst hätte, …
… hätte ich meine Geschichte trotzdem geschrieben?
Definitiv ja. Ganz einfach, weil es ein gutes Thema ist, und ich heute, ein halbes Jahr später, meine Geschichte immer noch mag. Aber ich hätte früher wissen können, dass es das falsche Umfeld ist.
Nur am Rande: Keine gute Figur machte meines Erachtens die Kommunikation von BoD (Books on Demand). Nach Ablauf der Frist für die Einreichung war es nahezu unmöglich, Informationen zum Wettbewerb zu finden. Völlig undurchsichtig blieb, wie die Jury ausgewählt hat. Bei 500+Einsendungen wäre es schon angemessen gewesen, über die 15 „Gewinner“, sorry, „Gewinner*innen“ hinaus die insgesamt ersten 50 mit den höchsten Punktzahlen genannt zu bekommen. Auch wie sich bei den 15 Auserwählten die Bewertungen innerhalb der sechs „Juror*innen“ verteilt haben, bleibt im Dunklen. Im übrigen waren, zumindest den Namen nach, auch 14 der 15 Ausgewählten weiblich.
Egal, hinterher ist man immer klüger. Jetzt zur Sache. Hier meine erfolglose Einreichung zum Wettbewerb „Love Between the Pages“:
Die Entscheidung
Niemand las. Ihr Vater las den Koran, sonst nichts. Ihre Brüder lasen nicht. Nur sie las. Es war ihr Weg gewesen, genügend Deutsch zu lernen, um weiterhin in die Schule zu gehen. Jetzt stand sie kurz vor dem Abitur. Als Einzige in ihrer Familie und als Erste von allen Vorfahren, die nur noch im Kopf ihres Vaters präsent waren.
Ihre Mutter hatte die Flucht nicht überlebt. Aber selbst wenn, sie hatte nie lesen gelernt.
Aziza stand vor dem Schaufenster eines Reisebüros mit Plakaten, die Ferienhotels an der türkischen Küste zeigten. Sie wusste, welche Lügen sich hinter diesen Bildern verbargen. Ihr einziger Gedanke war: Nie wieder will ich dort hin. Ich war gezwungen, das kennenzulernen und weiß, wie es an anderen Ecken dieser Küste zugeht.
Sie rückte sich das Kopftuch zurecht. Ferienreisen empfand sie als ein fremdes Wort. Warum muss man irgendwo hinfahren, nur weil man Zeit dafür hat?
Sieben Jahre waren vergangen, seitdem die einzige Alternative Deutschland hieß. Ihre kränkelnde Mutter hatte den Verlust ihrer Heimat in Afghanistan nicht verwinden können und war den widrigen Umständen der Flucht nach Europa nicht gewachsen gewesen. Sie wollte nicht nach Deutschland und hatte beschlossen zu sterben.
Ihr Vater arbeitete jetzt als Busfahrer und lobte täglich Allah, diese Möglichkeit bekommen zu haben. In Afghanistan hatte er die Überlandverbindungen des größten regionalen Busunternehmens in Kabul organisiert. Verschiedene Welten. Ihre zwei Brüder waren in Ausbildung und beide gaben einen Teil ihres Verdienstes an den Vater ab. Sie, Aziza, ging aufs Gymnasium und hatte nichts zum Abgeben. Sie kostete nur.
Ihr Schulweg führte mit einem kleinen Schlenker an einer Buchhandlung vorbei, die ihr den täglichen Trost spendete. Sie liebte diesen Umweg, der sie höchstens fünf Minuten kostete, nicht gerechnet die Zeit, die sie die Auslage im Fenster anschaute. Immer wenn sie früh genug dran war, lief sie an der Buchhandlung vorbei und sog die Buchtitel und Bilder im Schaufenster in sich hinein. Es war jedes Mal eine Reise in unbekannte Welten. In die Vergangenheit, in die Zukunft oder in Länder, deren Namen sie höchstens kannte, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie es dort aussah.
Bücher kaufen kam nicht in Frage, in der Bücherei leihen schon. Die Coming of Age Geschichten ihrer Mitschülerinnen hatten irgendwann den Reiz verloren. Sie wollte Literatur. Also fragte sie eine Mitarbeiterin der Bücherei, die selbst ihrer Heimat, dem Iran, vor vielen Jahren den Rücken gekehrt hatte.
»Fang mit etwas an, wo du zumindest den Hintergrund kennst«, sagte die und empfahl ihr afghanische Schriftsteller wie Atiq Rahimi und Khaled Hosseini.
Mittlerweile hatte sie ihren literarischen Horizont erweitert. Nach Westen mit Autoren wie T. C. Boyle und nach Osten unter anderen mit Haruki Murakami. Sie versank völlig in den imaginären Welten dieser Geschichten. Sie lebte und fühlte mit den Protagonisten und fand Ablenkung und Trost vom eigenen eher eintönigen Alltag und der Traurigkeit, die sie manchmal erfasste. So waren Bücher gleichzeitig Trost und Flucht, Vergnügen und Freude.
Ihre Familie betrachtete sie als Exotin, ihre Mitschüler nannten sie Buchfreak.
Irgendwann hängt bei der Buchhandlung dieser Zettel im Fenster: Ferienaushilfe gesucht! Lieferungen auspacken und Regale auffüllen. Sie hat das noch nie gemacht und sie kennt die Blicke von Leuten, denen sie zum ersten Mal begegnet. Ein Kopftuchmädchen! Und schlimmer: die Arme!
Sie weiß, dass sie dieses Problem verfolgen wird. Warum sich nicht gleich damit konfrontieren lassen? Sie nimmt all ihren Mut zusammen, öffnet die Tür der Buchhandlung und geht hinein.
»Bist du schon 18? Wenn nicht, brauche ich die Unterschrift von deinen Eltern.«
»Ich bin 18. Ich musste ein Jahr Deutsch lernen, bevor ich am Gymnasium weiter machen konnte.«
»Und dein Ausweis sagt das auch? Wenn ich dich einstelle, muss ich den sehen.«
»Ja!«
Sie bekam den Job. Ihrem Vater erzählte sie nichts. Die Gefahr, dass er es ihr verbieten wollte, erschien ihr zu groß. Es waren drei Vormittage die Woche, jeweils ein paar Stunden, und abgesehen davon, dass er selbst arbeitete, hatte er Vertrauen zu ihr. Da sie seiner Meinung nach fast immer lernte, würde sie wohl auch in der Ferien lernen.
Es war wie eine Offenbarung. Tausende von Büchern. Leseexemplare, die sie für ein paar Tage mitnehmen durfte. Belesene Kolleginnen, mit denen sie sich danach über diese Neuerscheinungen austauschen konnte. Sie liebte es. Meistens kam sie früher als vereinbart und blieb auch länger, was ihr scheinbar tadelnde Blicke der Chefin einbrachte. Es war wie ein Wohnzimmer, das sie selbst für sich eingerichtet hatte.
An einem Tag stand sie vor dem Regal mit Kriminalromanen und Thrillern. Überhaupt nicht ihr Ding, aber darauf kam es nicht an. Es war die Kategorie, in der Kunden beim Suchen die meiste Unordnung schafften, und sie sortierte gerade neu.
Ein Stück hinter ihr standen eine Kollegin und zwei Männer, die sich auf Dari unterhielten. Unauffällig drehte sie den Kopf. Sie sahen aus, als seien sie aus dem Iran. Die Sätze klangen ähnlich wie das Paschtu, das Vater noch manchmal mit ihr sprach. Dialekte. Wie Deutsch und Österreichisch, dachte sie.
Die Blicke ihrer Kollegin verrieten völlige Hilflosigkeit, obwohl die beiden Kunden auch versuchten, ihre Wünsche in Englisch zu äußern.
Sie ging hin und übersetzte. Ihr war rasch klar, was die zwei wollten. Sie übernahm das Gespräch, beriet sie und verkaufte ihnen mehrere teure Bildbände als Geschenk für zuhause. Dieser Erfolg hatte den Charakter eines Ritterschlags.
Ab diesem Moment wurde sie offensiver. Nicht, dass sie sich aufdrängte. Aber wenn sich Kunden in einsame Ecken der Buchhandlung verirrten, wo sie gerade ihrem Job nachging, bot sie ihre Hilfe an. Die Begeisterung ihrer Kolleginnen hielt sich in Grenzen, doch es verbot ihr auch niemand.
Einmal kam ein Mann ins Geschäft und ging direkt an die Kasse, hinter der die Inhaberin stand. Er wolle sich nur bedanken. Die drei Bücher, die ihm vor zwei Tagen empfohlen worden waren, seien exakt das, was er gesucht hatte.
»Wer hat Sie denn beraten?«, fragte sie erfreut.
»Den Namen kenne ich natürlich nicht. Aber es war die junge Frau mit …«, er räusperte sich, »… die mit dem Kopftuch.«
Aziza besuchte ein Wirtschaftsgymnasium und kannte sich mit Marketing aus. Und sie hatte das Gespräch mitbekommen. Das also ist mein Alleinstellungsmerkmal, ging ihr durch den Kopf. Immerhin besser, als wenn man sich gar nicht an mich erinnert. Aber gut fand sie das nicht.
Ihr nächster Arbeitstag war in der Woche darauf. Sie hatte das ganze Wochenende darüber gegrübelt und war noch immer nicht zu einer endgültigen Entscheidung vorgedrungen.
Sie begann mit ihren Routinearbeiten, es waren auch keine Kunden da. Aber selbst für die einfachsten Handgriffe fehlte ihr die nötige Konzentration. Eine innere Stimme sagte: So geht das nicht weiter und für den Fortgang der Welt hat das, was an dir nagt, keinerlei Bedeutung.
Also gab sie sich einen Ruck, ging in den Personalraum und stellte sich vor den Spiegel über dem Waschbecken. Langsam entwirrte sie den Stoff, dann zog sie das Kopftuch herunter. Kurz überkam sie eine Welle von Erregung, die aber sofort wieder abklang. Du hast ein Ziel, sagte sie sich. Verliere dich nicht in Gefühlen.
Sie klopfte bei der Chefin. »Die Tür ist offen«, tönte es von innen.
Aziza trat ein und ging nach vorne zum Schreibtisch. Die Leiterin der Buchhandlung war offensichtlich echt überrascht. »Was ist denn mit dir los?«, sagte sie und schaute mit einer Mischung aus Überraschung und Gefallen auf Azizas gelockte Mähne, die sich über ihre Schultern ergoss.
»Ich möchte mehr mit Kunden arbeiten«, sagte Aziza. »Ich höre seit Wochen am Rande die Kundengespräche und ich weiß, ich kann das auch. Und nicht nur mit Leuten aus meiner Heimat.«
»Dafür musst du nicht unbedingt das Kopftuch weglassen. Dir ist schon klar, dass das eine Entscheidung ist, die weit über deine Arbeit hier in der Buchhandlung hinausgeht?«
Aziza nickte und wischte sich eine Träne aus dem Auge. »Ja, das ist mir klar. Aber egal, für was ich mich entscheide, mit beiden Möglichkeiten bin ich im Zweifel. Und die hier«, dabei deutete sie auf ihre schwarze Mähne, »kenne ich noch nicht. Wenn ich nach der Arbeit hier rausgehe, ziehe ich es sowieso wieder an.«
Die Chefin schaute sie eine Weile an und überlegte. »Du bist wirklich mutig. Und du bist in der Tat nicht jemand, der nur Regale einräumen sollte.« Sie schwieg erneut einen Augenblick und fuhr dann fort. »Wir probieren das. Du machst zunächst weiter wie bisher. Und wenn es draußen eng wird, kommst du dazu. Und dann sehen wir, wie sich das entwickelt.«
Aziza nickte. »Danke. Das ist wunderbar. Wunderbar, dass Sie mir das zutrauen. Ich werde Sie nicht enttäuschen.«
Das anfängliche Empfinden einer Blöße wich schneller, als sie erwartet hatte. Sie fühlte sich ernster genommen. Wenn sie bediente, mochten die Kunden sie. Das gab ihr ein völlig neues, gutes Gefühl. Sie zeigte eine ernsthafte Hingabe, das zu finden, was diese zu suchen meinten, soweit sie nicht direkt nach bestimmten Titeln fragten. Wenn sie nicht weiter wusste, holte sie eine ihrer Kolleginnen.
Es war ein gewöhnlicher Tag. Das Glöckchen an der Eingangstür zur Buchhandlung ertönte. Aziza dachte sich nichts dabei. Das passierte täglich hunderte Male. Sie füllte Regale im hinteren Bereich mit Neuerscheinungen auf, die frühmorgens der Lieferdienst des Buchgroßhändlers gebracht hatte. Die Kochbücher sahen auch so aus, als müssten sie neu sortiert werden. Alphabetisch war klar. Aber nach Autoren? Nach Titeln? Oder vielleicht nach Ländern? Aziza grübelte, als eine ihrer Kolleginnen auftauchte.
»Kannst du mir helfen. Ich habe da wieder einen Hamdullah. Der kann zwar Deutsch, aber bei der Beschreibung, was er sucht, blicke ich nicht durch. Geht wohl um ein Geburtstagsgeschenk für seine Tochter.«
Aziza legte die drei Bücher wieder auf die Kiste, schob die widerspenstigen Haare hinter die Ohren und benetzte ihre Lippen. »Bin schon unterwegs.«
Der Mann stand mit dem Rücken zu ihr und schaute sich die Bände in den Aufstellern an. Er trug westliche Kleidung, außer einer kurzen Kurta, einem für Afghanen typischen Hemd, das an ihm aussah wie ein weites, über der Hose getragenes Shirt.
Sie sprach ihn auf Paschtu an und registrierte, dass er zusammenzuckte. Dann drehte er sich um. Er öffnete den Mund, aber sagte keinen Ton. Aziza überkam ein Gefühl vollständiger Lähmung. Er schaute sie an. Von oben nach unten und von unten zurück nach oben. Dort blieb sein Blick auf ihren unbedeckten Haaren hängen. Er drehte sich wortlos um und wollte gehen.
»Vater!«
Er blieb stehen und wendete den Kopf. »Was machst du hier? Wie siehst du aus?«
»Vater«, ihre Stimme klang verzweifelt, »es ist nur für hier, und …«, sie stockte, »niemand hat das von mir verlangt. Es war meine Entscheidung.«
»Und warum dann die unbedeckten Haare?«
»Komm mit. Nicht hier!« Sie packte ihn am Arm und zog ihn nach hinten in die Nähe des Personalraums, wo sie niemand sah.
»Versuche doch zu verstehen. Wir werden hier nie mehr weggehen. Jedenfalls nicht nach Afghanistan. Und ich will sein wie alle hier und nicht immer nur das Kopftuchmädchen.«
Der Vater schluckte. »Und warum arbeitest du hier, wo du dich nicht aufdringlichen Blicken von Männern entziehen kannst?«
Aziza gewann ihre Sicherheit langsam zurück. »Vater, wir sind hier nicht auf dem Bau. Das ist eine Buchhandlung. Hier gibt es Dinge, die mich glücklich machen und mit denen ich mich gerne umgebe. Außerdem verdiene ich Geld!«
»Wofür musst du Geld verdienen?«
»Auch ich brauche manchmal Geld. Und ich will dich nicht immer bitten müssen.« Sie zögerte einen Moment. »Im Gegenteil, ich denke, es wird Zeit, dass auch ich meinen Anteil in die Familienkasse gebe.«
Einen Moment schien er nicht zu wissen, was er sagen sollte. »Die Familie zu ernähren, ist Männersache«, kam dann in wenig überzeugendem Ton.
»Du weißt selbst, dass das nicht stimmt. Ich arbeite gerne hier, und wenn ich dafür Geld bekomme, ist es selbstverständlich, davon einen Teil abzugeben, so wie meine Brüder. Ich fühle mich gut, wenn ich das kann – Mutter wäre jedenfalls stolz auf mich.« Sie erschrak. Diese letzten Worte hätte sie besser für sich behalten.
Ihr Vater schaute sie an und sie bemerkte, dass seine Augen feucht wurden.
»Gib mir dein Kopftuch.« Das kam mehr als Aufforderung denn als Bitte. Sie zögerte. Er wiederholte den Satz und sie wollte ihn nicht noch mehr enttäuschen. Also ging sie an ihren Spind, holte das Kopftuch und reichte es ihm.
Er nahm es, faltete es und steckte es ein.
»Was machst du? Was soll das?«
»Ich möchte es als Erinnerung. Als Erinnerung an mein Kind, das kein Kind mehr ist. Du bist 18 Jahre alt. Du bist erwachsen und entscheidest selbst.« Er schluckte. »Ich habe deine Mutter verloren. Dich will ich nicht verlieren. Ich liebe dich – mit und ohne Kopftuch.«
Er drückte sie an sich und sie spürte, wie eine Träne in ihr Haar fiel und und sich den Weg auf ihren Kopf suchte.
Bild von Mollyroselee auf Pixabay
Letzter Beitrag: Schreibratgeber: Hugh Howey’s Writing Insights
Zur Übersicht aller Blog-Beiträge